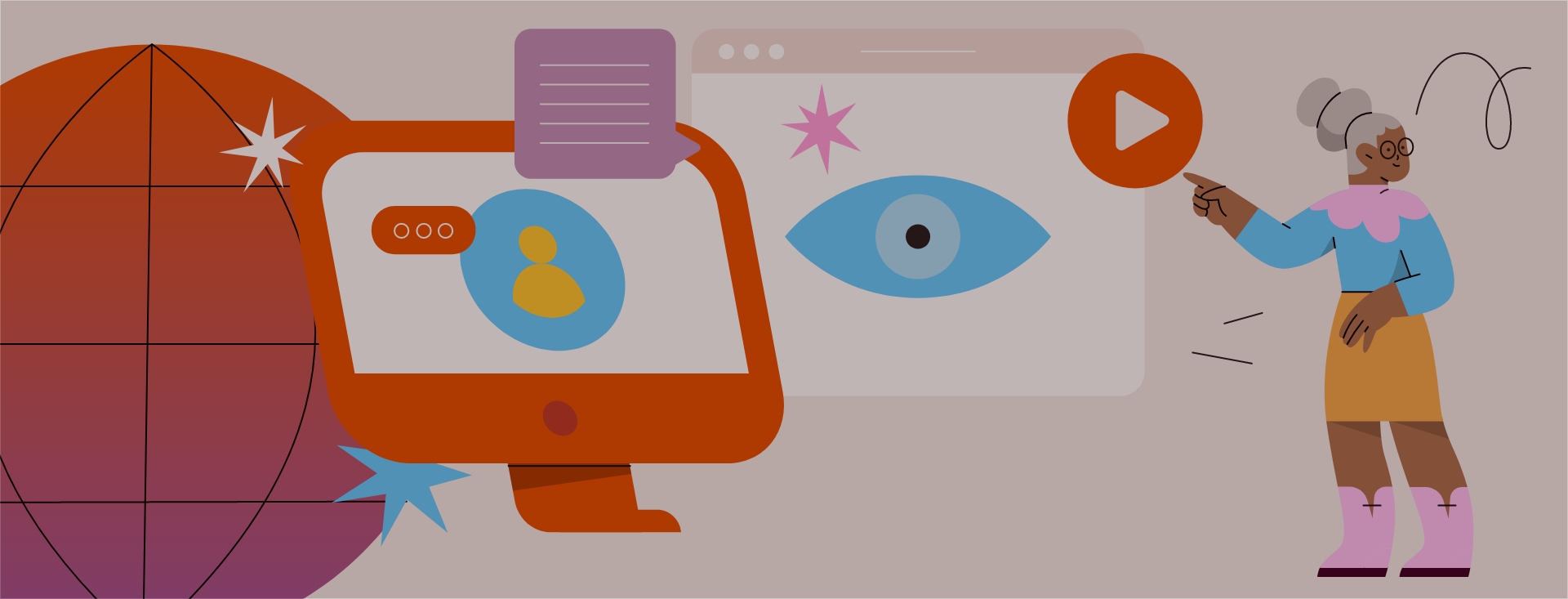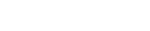Je digitaler die Welt wird, desto entscheidender ist es, dass alle Menschen gleichberechtigten Zugang zu Informationen, Produkten und Dienstleistungen haben. Doch noch immer stoßen viele Nutzer mit Behinderungen auf Hürden im digitalen Raum. Hier setzt das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) an – ein gesetzlicher Rahmen für mehr digitale Teilhabe: Es sorgt dafür, dass digitale und physische Angebote barrierefrei gestaltet werden. Dies betrifft vor allem Unternehmen, die digitale Services oder Produkte für Endkunden bereitstellen – etwa Onlineshops, Banken, Telekommunikationsanbieter oder Transportunternehmen.
Wer sich jetzt mit den Anforderungen des BFSG auseinandersetzt, schafft nicht nur Chancengleichheit, sondern profitiert von einer erweiterten Zielgruppe, besserer Usability und höherer Rechtssicherheit. In diesem Artikel erfahren Sie, was das BFSG genau bedeutet, welche Unternehmen es betrifft, welche Ausnahmen gelten und wie Sie Ihre digitalen Angebote barrierefrei gestalten können.
Contents
- Warum Barrierefreiheit im digitalen Zeitalter unverzichtbar ist
- Rechtliche Einordnung: BFSG, BITV, WCAG und EAA – wie hängt das alles zusammen?
- Wen betrifft das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz?
- Wer ist vom Barrierefreiheitsgesetzt ausgenommen?
- Was ist eine barrierefreie Website?
- Website barrierefrei gestalten: Was sind die Anforderungen an die digitale Barrierefreiheit?
- Welche Vorteile hat Barrierefreiheit für Unternehmen?
- Zeit zum Handeln: Frist bis 2025
- In 5 Schritten zur barrierefreien Website – Fahrplan für Entscheider
- Ist Ihre Website bereit für die Anforderungen des BFSG?
Warum Barrierefreiheit im digitalen Zeitalter unverzichtbar ist
Barrierefreiheit im digitalen Raum ist nicht nur ein Gebot der Fairness und Inklusion, sondern wird für viele Unternehmen bald zur gesetzlichen Pflicht. Mit dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) setzt Deutschland die EU-Richtlinie 2019/882 um und verpflichtet Unternehmen dazu, ihre Produkte und Dienstleistungen zugänglich für Menschen mit Behinderungen zu gestalten. Das Gesetz tritt schrittweise bis 28. Juni 2025 in Kraft. Wer sich jetzt vorbereitet, stellt sicher, dass alle Nutzer optimal erreicht werden – und vermeidet rechtliche Konsequenzen.
Rechtliche Einordnung: BFSG, BITV, WCAG und EAA – wie hängt das alles zusammen?
Barrierefreiheit im digitalen Raum wird durch verschiedene Gesetze und Normen geregelt, die sich ergänzen. Um die Anforderungen korrekt umzusetzen, ist es wichtig, ihre Rollen und Unterschiede zu verstehen:
- EAA (European Accessibility Act)
Die EU-Richtlinie 2019/882 bildet die europäische Grundlage für digitale Barrierefreiheit. Sie legt fest, dass bestimmte Produkte und Dienstleistungen barrierefrei zugänglich sein müssen – insbesondere, wenn sie EU-weit vertrieben oder bereitgestellt werden. Diese Richtlinie musste von den Mitgliedstaaten in nationales Recht überführt werden. - BFSG (Barrierefreiheitsstärkungsgesetz)
Das BFSG ist die deutsche Umsetzung des EAA. Es verpflichtet Unternehmen ab Juni 2025 dazu, definierte Produkte und Dienstleistungen barrierefrei anzubieten – unter anderem Webseiten, Apps, E-Commerce-Plattformen, Bank- und Telekommunikationsdienste sowie Geräte wie Smartphones oder Geldautomaten. Es richtet sich vor allem an privatwirtschaftliche Unternehmen, die Leistungen für Verbraucher erbringen. - BITV (Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung)
Die BITV ist eine nationale Verordnung, die sich primär an öffentliche Stellen (z. B. Behörden, Ministerien, öffentlich-rechtliche Institutionen) richtet. Sie regelt, wie digitale Angebote der öffentlichen Hand barrierefrei gestaltet sein müssen. Anders als das BFSG gilt sie nicht für privatwirtschaftliche Unternehmen – es gibt aber viele inhaltliche Überschneidungen. - WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)
Die WCAG sind internationale technische Standards, die von der W3C-Initiative entwickelt wurden. Sie definieren, was technisch und gestalterisch unter Barrierefreiheit zu verstehen ist. Sowohl das BFSG als auch die BITV nehmen die WCAG 2.1 als verbindliche Grundlage – auf dem Konformitätsniveau AA. Das heißt: Wer WCAG 2.1 AA erfüllt, erfüllt in der Regel auch die Anforderungen des BFSG.
Die EU gibt mit dem EAA die Richtung vor, das BFSG setzt diese in deutsches Recht für Unternehmen um, die BITV regelt Barrierefreiheit für den öffentlichen Sektor, und die WCAG geben den technischen Rahmen für alle. Für Unternehmen, die sich an den WCAG 2.1 AA orientieren, sind sie inhaltlich auf der sicheren Seite.
Wen betrifft das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz?
Das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) betrifft Unternehmen, die digitale oder physische Produkte und Dienstleistungen für Verbraucher anbieten. Die Regelung gilt unabhängig von der Branche – entscheidend ist, ob das Angebot für Endnutzer bestimmt ist.
Besonders betroffen sind Unternehmen aus folgenden Bereichen:
- Online-Shops und digitale Handelsplattformen
- Banken, Versicherungen und Finanzdienstleister
- Telekommunikationsanbieter
- Verkehrsdienstleister (z. B. Ticketverkauf, Fahrgastinformationen)
- Streaming- und Kommunikationsdienste
- Anbieter von E-Books, Lesegeräten und Apps
- Hersteller von Geräten wie Smartphones, Tablets, Geld- oder Fahrkartenautomaten
Kurz gesagt: Wenn Ihr Unternehmen digitale oder digitale-gestützte Leistungen für Verbraucher anbietet, müssen Sie Ihre Produkte bis spätestens 28. Juni 2025 barrierefrei gestalten.
Wer ist vom Barrierefreiheitsgesetzt ausgenommen?
Nicht alle Unternehmen und Dienstleistungen sind vom Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) betroffen. Es gibt gezielte Ausnahmeregelungen, um kleinere Betriebe oder bestimmte Szenarien zu berücksichtigen, in denen eine barrierefreie Umsetzung unverhältnismäßig oder technisch nicht realisierbar ist.
- Kleinstunternehmen: Unternehmen mit weniger als 10 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von unter 2 Millionen Euro sind von den gesetzlichen Vorgaben ausgenommen. Dennoch kann eine freiwillige Umsetzung strategisch sinnvoll sein – etwa zur Steigerung der Reichweite und Kundenzufriedenheit.
- B2B-Unternehmen: Wer ausschließlich Dienstleistungen oder Produkte für Geschäftskunden anbietet und nicht an Endverbraucher verkauft, fällt nicht in den Anwendungsbereich des BFSG.
- Unverhältnismäßige Belastung: In begründeten Fällen (z. B. bei extrem hohem Aufwand) können Unternehmen beantragen, von einzelnen Anforderungen befreit zu werden. Ein nachvollziehbarer Nachweis ist hierfür erforderlich.
- Bestandsprodukte und Inhalte: Inhalte oder Software, die vor dem Inkrafttreten des Gesetzes erstellt wurden und seitdem nicht wesentlich geändert wurden, sind nicht betroffen – sofern sie nicht aktiv beworben oder regelmäßig genutzt werden.
Trotz dieser gesetzlichen Ausnahmen ist es natürlich für jedes Unternehmen zukunftsweisend, digitale Angebote so inklusiv wie möglich zu gestalten. Barrierefreiheit erhöht nicht nur die Reichweite und Benutzerfreundlichkeit, sondern stärkt auch das Image und die Rechtssicherheit.
Was ist eine barrierefreie Website?
Eine barrierefreie Website ermöglicht es Menschen mit unterschiedlichen Einschränkungen, digitale Inhalte vollständig und ohne Hürden zu nutzen. Dabei geht es nicht nur um körperliche oder sensorische Behinderungen wie Seh- oder Hörbeeinträchtigungen, sondern auch um kognitive oder motorische Einschränkungen. Eine barrierefreie Website verbessert das Nutzererlebnis für alle Menschen, nicht nur für Personen mit Behinderungen. Sie bietet bessere Usability, stärkt die Suchmaschinenoptimierung (SEO) und reduziert rechtliche Risiken. Unternehmen, die frühzeitig auf Barrierefreiheit setzen, schaffen eine inklusive und zukunftssichere digitale Präsenz.
Website barrierefrei gestalten: Was sind die Anforderungen an die digitale Barrierefreiheit?
Das Gesetz orientiert sich an den international anerkannten Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1) auf dem Niveau AA. Die wichtigsten Anforderungen sind:
Wahrnehmbarkeit: Inhalte und Funktionen müssen so gestaltet sein, dass sie von allen Nutzern erfasst werden können.
- Klare Alternativ-Texte für Bild: Blinde oder sehbehinderte Nutzer sollten Bilder durch Screenreader erfasst bekommen.
- Bildunterschriften & Teaser im Text
- Zahlen im Bild sollten nochmal im HTML-Tabellen erklärt werden
- Farben & Kontraste sollten anpassbar sein, um die Lesbarkeit zu verbessern
- Inhalte sollten für Nutzer mit Sehschwächen anpassbar sein (z. B. durch Vergrößerung der Schrift).
Bedienbarkeit: Die Website muss vollständig und intuitiv bedienbar sein, auch ohne Maus.
- Tastatur-Steuerung, um durch die Inhalte zu navigieren.
- Fokus-Indikatoren, um zu zeigen, welche Elemente aktuell ausgewählt sind.
- Vermeidung von Zeitlimits, um Nutzern mit langsameren Reaktionen genügend Zeit zu geben.
Verständlichkeit: Die Inhalte sollten klar und einfach strukturiert sein.
- Klare Struktur & leicht verständlichen Texten mit klaren Überschriften und kurzen Absätzen.
- einfache Navigation & klare Menüpunkte, um die Orientierung zu erleichtern.
- Videos mit Transkription & Untertiteln, um Inhalte für hörgeschädigte Nutzer zugänglich zu machen.
Robustheit: Eine barrierefreie Website sollte auf verschiedenen Geräten und mit unterschiedlichen Technologien funktionieren.
- Responsives Design, das sich an verschiedene Bildschirmgrößen anpasst.
- Sauberer HTML-Code und die Nutzung von ARIA-Attributen, um Assistenztechnologien wie Screenreader zu unterstützen.
Mit diesen Anforderungen soll die digitale Teilhabe von Menschen mit Behinderungen sichergestellt werden, damit jeder, egal welche Einschränkung er oder sie hat, den gleichen Zugang zu digitalen Informationen und Services hat.
Welche Vorteile hat Barrierefreiheit für Unternehmen?
Barrierefreiheit bietet nicht nur Vorteile für Menschen mit Behinderungen, sondern auch für Unternehmen selbst:
- Erweiterte Zielgruppen: Barrierefreie Websites sind für alle zugänglich, wodurch neue Kundengruppen erschlossen werden.
- SEO-Vorteile: Barrierefreie Websites sind oft besser für Suchmaschinen optimiert, da klare Strukturen und alternative Texte zu einer besseren Indexierung führen.
- Bessere Usability: Eine zugängliche Website verbessert das Nutzererlebnis für alle Besucher, nicht nur für Menschen mit Behinderungen.
- Rechtssicherheit: Unternehmen, die die Vorgaben erfüllen, minimieren das Risiko von Klagen und Bußgeldern.
Zeit zum Handeln: Frist bis 2025
Die Frist zur Umsetzung des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes endet am 28. Juni 2025. Für kleine Unternehmen mit weniger als 10 Beschäftigten und einem Umsatz von unter 2 Millionen Euro gibt es zwar Ausnahmeregelungen, dennoch lohnt es sich für jedes Unternehmen, digitale Barrierefreiheit zu gewährleisten.
Wer frühzeitig mit der Umsetzung beginnt, kann die notwendigen Anpassungen schrittweise und ohne Zeitdruck vornehmen. Denn Barrierefreiheit ist nicht einfach ein „Zusatz-Feature“, sondern ein entscheidender Faktor für die Zukunftsfähigkeit digitaler Angebote.
In 5 Schritten zur barrierefreien Website – Fahrplan für Entscheider
Viele Unternehmen wissen, dass sie handeln müssen – aber nicht, wie der Prozess konkret aussieht. Statt sich sofort mit technischen Details zu befassen, ist ein klarer strategischer Fahrplan hilfreich. Hier sind fünf zentrale Schritte für Entscheider, um das Thema strukturiert und zukunftssicher anzugehen:
- Verantwortlichkeiten klären
Bestimmen Sie intern, wer für Barrierefreiheit zuständig ist – idealerweise eine Schnittstelle zwischen Webentwicklung, UX und Compliance. - Bestandsaufnahme durchführen
Beauftragen Sie ein erstes Barrierefreiheits-Audit oder nutzen Sie Tools wie WAVE, um die größten Schwachstellen zu identifizieren. - Relevante Seiten und Produkte priorisieren
Nicht alles muss auf einmal angepasst werden. Starten Sie mit den zentralen Nutzerpfaden: z. B. Startseite, Checkout, Produktdetailseiten, Kontaktformulare. - Agentur oder Fachpartner einbinden
Barrierefreiheit ist kein „One-off-Projekt“. Holen Sie Expertise ins Haus – für Strategie, Umsetzung und langfristige Qualitätssicherung. - Monitoring und Nachbesserung etablieren
Definieren Sie KPIs (z. B. Konformität mit WCAG), dokumentieren Sie Fortschritte und integrieren Sie Barrierefreiheit dauerhaft in Entwicklungsprozesse.
Wer strukturiert vorgeht, muss Barrierefreiheit nicht als Last sehen, sondern kann sie schrittweise und mit vertretbarem Aufwand umsetzen – mit echtem Mehrwert für alle Nutzergruppen.
Ist Ihre Website bereit für die Anforderungen des BFSG?
Mit dem Barrierefreiheitsgesetz wird ein wichtiger Schritt in Richtung einer inklusiven digitalen Welt gegangen. Die Umsetzung von Barrierefreiheit erfordert Know-how und eine genaue Analyse bestehender Websites und digitaler Angebote. Lassen Sie Ihre Website jetzt auf Barrierefreiheit prüfen und identifizieren Sie Optimierungspotenziale.
Als E-Commerce-Agentur stehen wir unseren Kunden im Online-Handel natürlich zur Seite und unterstützen sowohl in der Beratung, Umsetzungsplanung als auch in der Implementierung aller Anforderungen.